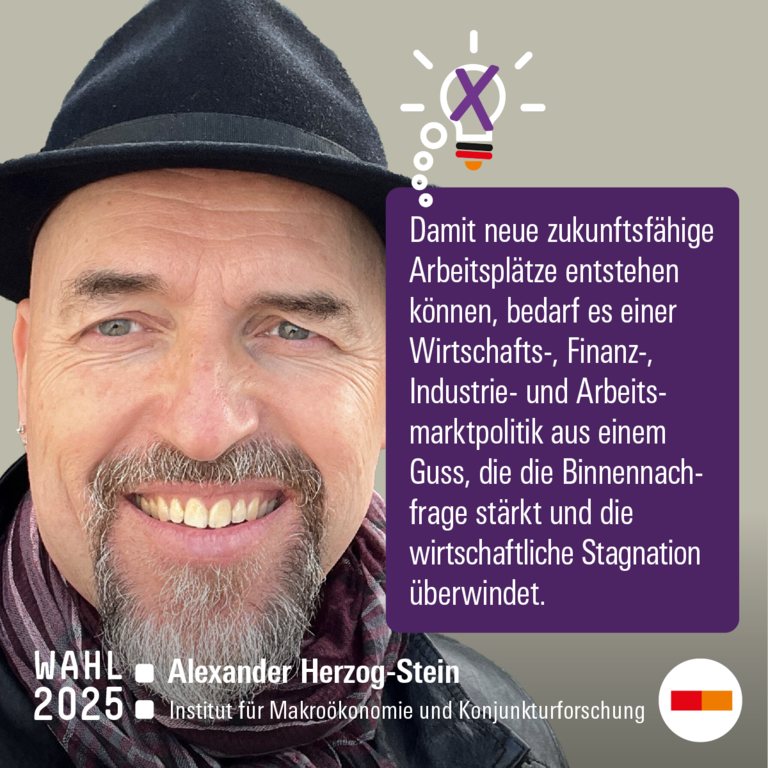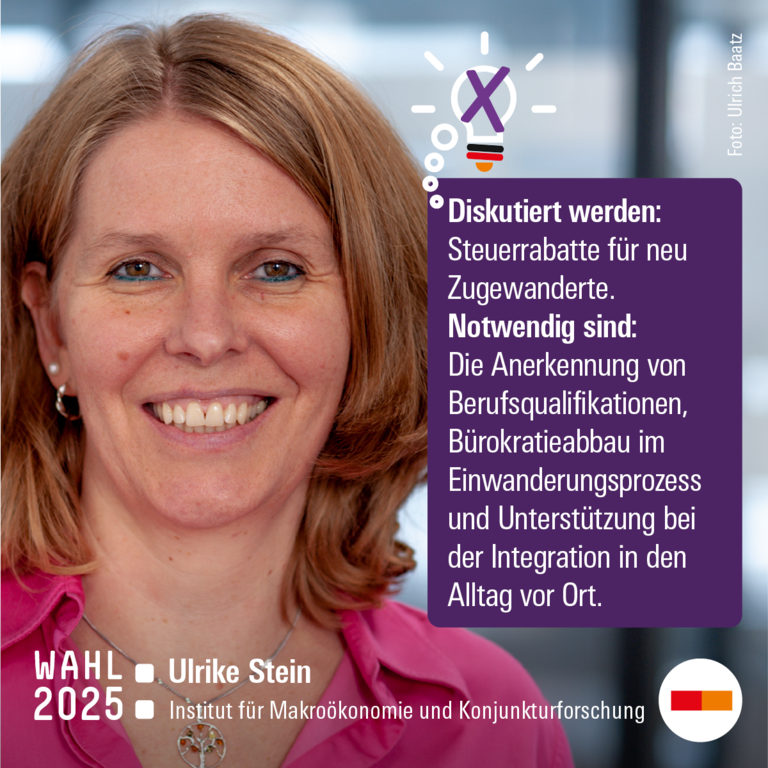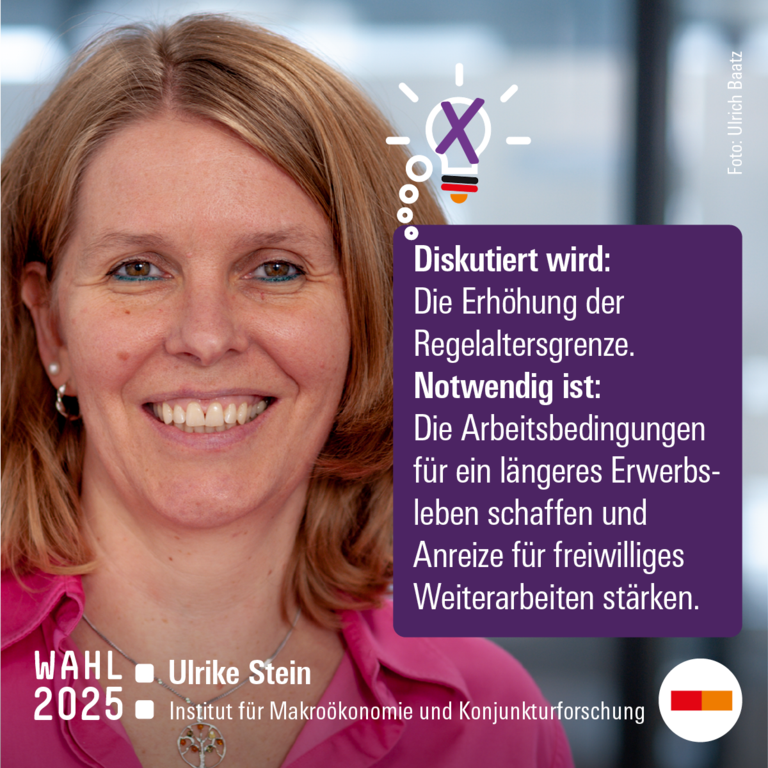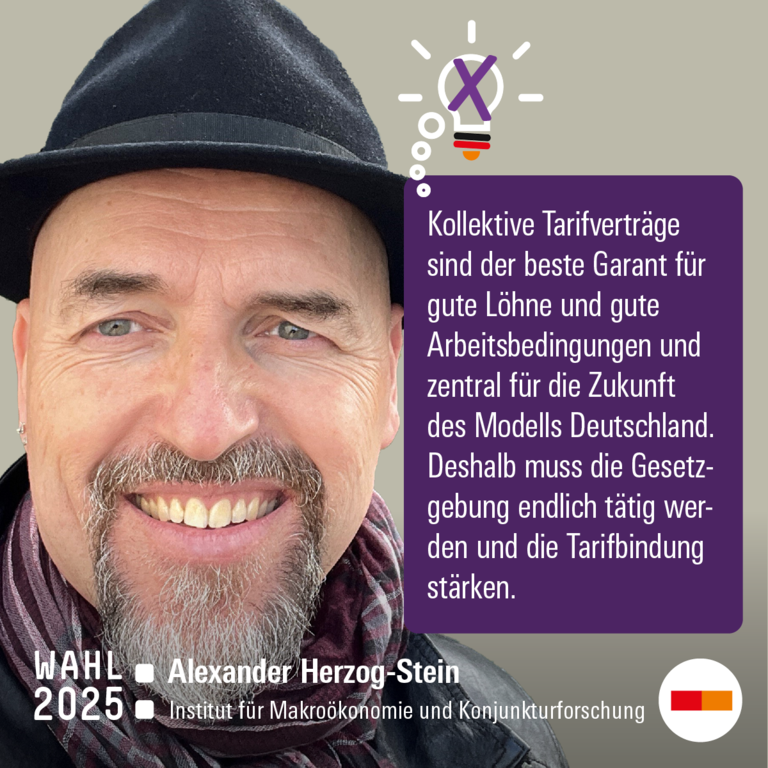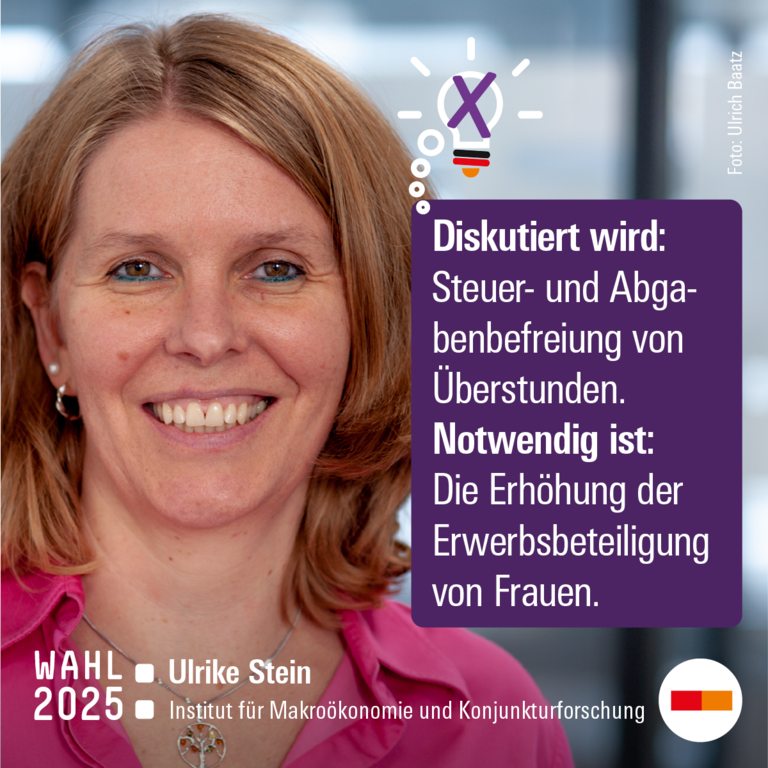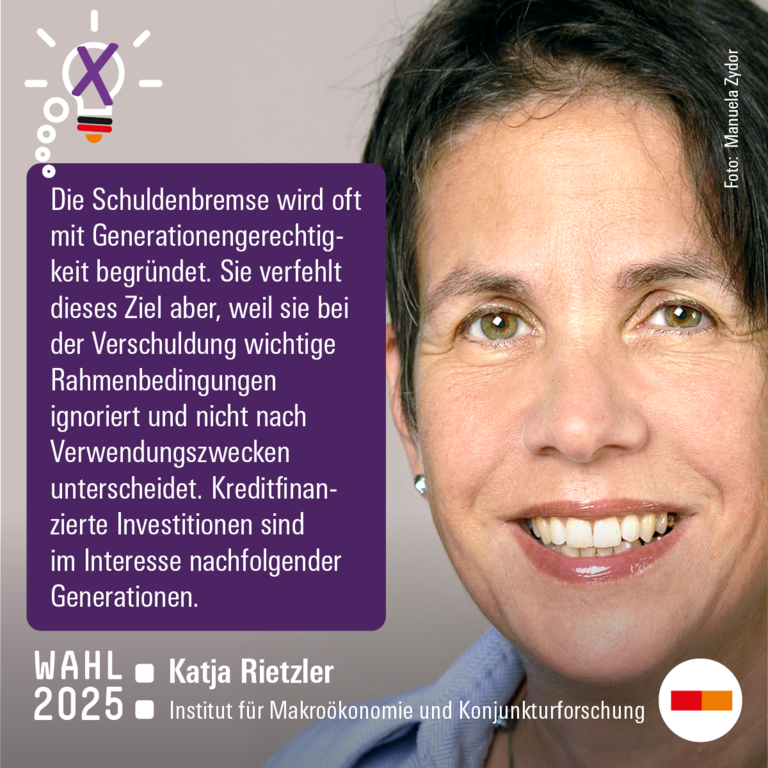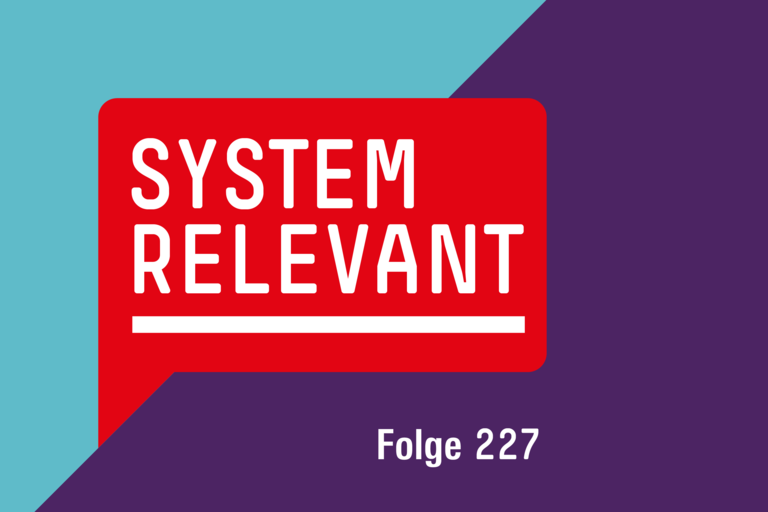Quelle: IMK
: Ideen zur Bundestagswahl 2025
Ideen und Vorschläge von Forscher:innen des IMK zu Themen die aktuell, anlässlich der Bundestagswahl, in der Politik diskutiert werden.
Öffentliche Investitionsoffensive
Es besteht breiter Konsens über den Sanierungsbedarf der deutschen Infrastruktur. Dabei wird der zusätzliche Investitionsbedarf auf 600 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahren für Verkehr, Energienetze, Dekarbonisierung und Bildung geschätzt. Ökonomisch spricht vieles für eine kreditfinanzierte Lösung dieser Mammutaufgabe. Eine solche kreditfinanzierte öffentliche Investitionsoffensive hat unseren Simulationen zufolge deutliche positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum und die private Investitionstätigkeit. Die Schuldenquote liegt zwar zeitweise etwas höher als ohne ein solches Programm, fällt aber auch mit dem Programm kontinuierlich. Ab 2029 läge die Schuldenquote dauerhaft unter 60 % und würde mit dem Ende des Programms beschleunigt fallen.
Verteilung und Leistungsbilanz
Die deutsche Volkswirtschaft weist seit etwa 20 Jahren einen hohen Leistungsbilanzüberschuss auf. Da diese Überschüsse mit entsprechend hohen Defiziten in anderen Ländern einhergehen, ergibt sich die latente Gefahr von Schuldenkrisen und protektionistischer Handelspolitik im Ausland, was auch Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland bedroht. Die hohen Exportüberschüsse Deutschlands spiegeln einen strukturellen inländischen Nachfragemangel wider, der sich insbesondere durch die schwache Entwicklung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte ergibt. Deren Anteil an den gesamtwirtschaftlichen Einkommen ist in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken: von über 68 Prozent in den 1990er Jahren auf knapp über 60 Prozent in den vergangenen Jahren. Um die binnenwirtschaftliche Nachfrage anzukurbeln und die hohen Leistungsbilanzüberschüsse abzubauen, ist eine Stärkung der privaten Haushaltseinkommen erforderlich, etwa durch höhere Mindestlöhne und die Stärkung des Flächentarifvertragssystems.
Kurzfristige Verbesserung – Impulse nachhaltiger Wachstumspolitik
Alexander Herzog-Stein: Zuletzt hat die anhaltend stagnierende Wirtschaftsentwicklung auch den bisher robusten Arbeitsmarkt erreicht. Neben der steigenden Arbeitslosigkeit, stagniert nunmehr auch die Beschäftigung und die Arbeitsmarktaussichten 2025 sind merklich eingetrübt. Damit neue zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen, die Arbeitslosigkeit abnimmt und sich somit die Arbeitsmarktsituation merklich verbessert, muss dringend die anhaltende wirtschaftliche Stagnation überwunden werden. Notwendig hierzu sind hierfür eine konjunktur- und wachstumsgerechte Wirtschafts-, Finanz, Industrie- und Arbeitsmarktpolitik aus einem Guss, die die Binnennachfrage stärkt.
Gesteuerte Arbeitsmigration
Ulrike Stein: Um den zukünftigen Fachkräftebedarf zu decken, müssen fehlende Arbeitskräfte aus gezielter Arbeitsmigration gewonnen werden. Dazu ist es notwendig den Bedarf zu ermitteln und gezielt die Hürden der Arbeitsmigrant*innen abzubauen. Diese sind neben der Bürokratie im Einwanderungsprozess und Problemen bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen vor allem die fehlende Unterstützung bei der Integration in den Alltag vor Ort (Diskriminierung bei der Wohnungssuche, Kinderbetreuung). Der Bürokratieabbau und die Schaffung vernünftiger Rahmenbedingungen würden die Arbeitsmigration spürbar erleichtern. Weniger großen Nutzen wird dahingegen eine teilweise Befreiung von Steuern und Abgaben haben, so wie es in dem Programm zum Anwerben von Fachkräften vorgeschlagen wurde. Vielmehr ist zu erwarten, dass die fiskalischen Effekte dieser Maßnahme aufgrund von Mitnahmeeffekten von Personen, die ohnehin nach Deutschland gekommen wären, negativ sein werden.
Der Netzausbau sollte nicht zum Strompreistreiber werden
Tom Bauermann: Die Strompreise in Deutschland, einschließlich Steuern und Abgaben, befinden sich im Moment noch über den Preisen von 2019, auch für Haushalte. Dies erschwert den Umstieg auf Wärmepumpe und E-Mobilität. Der notwendige Stromnetzausbau droht die Strompreise durch die Netzentgelte weiter zu erhöhen. Ein stärkeres staatliches Engagement beim Netzausbau, z.B. in Form von Garantien oder Eigenkapitalbeteiligungen bei den Netzbetreibern, könnte die Preisanstiege beim Strom eindämmen (Kaczmarczyk und Krebs 2025). Hierbei können die günstigen Zinskonditionen des Staates für den Netzausbau genutzt werden.
Regierung als Preistreiber
Silke Tober: Angesichts der Preisschocks der vergangenen Jahre sollte die Bundesregierung es vermeiden, selbst zum Preistreiber zu werden. Im vergangenen Jahr hat die Ampelregierung durch zahlreiche Maßnahmen einen schnelleren und deutlicheren Rückgang der Inflation in Deutschland verhindert. Auch in diesem Jahr wirken Maßnahmen wie die Erhöhung des CO2-Preises, die günstigeren Abschreibungsmöglichkeiten für die Gasnetze und die Verteuerung des Deutschlandtickets preistreibend. Da die Preise für Erdgas, Heizöl und Kraftstoffe das Niveau von 2019 im vergangenen Jahr um 92,3 %, 30,8 % bzw. 31,3 % übertrafen und der Preisanstieg einkommensschwache Haushalte und Familien besonders stark trifft, sollten zumindest an anderer Stelle preissenkende und klimapolitische sinnvolle Maßnahmen umgesetzt werden, die verteilungspolitisch kompensierend wirken, beispielsweise durch eine Verringerung des Strompreises.
Entlastung der Mittelschicht
Katja Rietzler: Vielfach werden weitere Steuersenkungen zur Entlastung der Mittelschicht gefordert. Das geht aber am wahren Problem vorbei. Bis zu einem Jahreseinkommen von über 70.000 Euro zahlt eine alleinstehende Person mehr an Sozialbeiträgen als an Einkommensteuer. Während die Steuerbelastung jüngst auch für mittlere Einkommen deutlich reduziert wurde, steigen die Sozialbeiträge wieder deutlich an. Hier gab es 2022 und 2023 durch die Ausweitung der Midi-Job-Zone nur für niedrige Einkommen eine Entlastung. Da den Sozialversicherungen eine Reihe von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben aufgebürdet werden (sogenannte versicherungsfremde Leistungen), für die der Bund einen unzureichenden Ausgleich leistet, sind die Beitragssätze höher als sie es bei einer gerechten Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen aus Steuermitteln wären. Hier sollte man ansetzen, um die Mitte zu entlasten.
Abfederung Fachkräftemangel durch Erhöhung Erwerbsquoten älterer Personen
Ulrike Stein: Um den Fachkräftemangel abzufedern und das Rentensystem zu stabilisieren, werden verschiedene Optionen diskutiert, die die Erwerbsquoten älterer Personen erhöhen sollen. Eine Forderung ist die weitere Anhebung der gesetzlichen Regelaltersgrenze, obwohl der Prozess der Anhebung auf 67 Jahre noch gar nicht abgeschlossen ist. Tatsächlich ist aber gesamtwirtschaftlich nicht entscheidend, ob die gesetzliche Regelaltersgrenze steigt, sondern wie man das tatsächliche Renteneintrittsalter erhöhen kann. Dazu sollten die Arbeits- und Rahmenbedingungen so verbessert werden, dass möglichst viele Menschen es auch schaffen, länger zu arbeiten. Für diejenigen, die gesund sind, sollten Anreize geschaffen werden, bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter zu arbeiten; gegebenenfalls sind weitere Möglichkeiten für gleitende und selbstbestimmte Übergänge von der Erwerbstätigkeit in die Rente zu schaffen, so wie sie bereits mit der Teilzeit- oder Flexirente möglich sind. Es muss aber auch möglich sein, dass Personen freiwillig länger arbeiten können. Dazu ist es richtig, schnellstmöglich die bürokratischen Hürden für eine Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmer zu beseitigen. Auch zusätzliche finanzielle Anreize können sinnvoll sein. Als gesamtgesellschaftliche Aufgabe müssen diese dann aber steuerfinanziert sein und dürfen nicht zu Lasten der Sozialversicherungen gehen.
Tarifbindung
Alexander Herzog-Stein: Das deutsche System der industriellen Beziehungen hat in der Vergangenheit wesentlich zum Erfolg der deutschen Wirtschaft beigetragen. Infolge des langjährigen Rückgangs der Tarifbindung liegt diese mit etwa 50 % deutlich unterhalb des Schwellenwerts von 80 % der Europäischen Mindestlohnrichtline (2022, Art. 4 (2)). Politische Maßnahmen, die das System nachhaltig stabilisieren würden, sind aber bislang ausgeblieben. Im Zuge einer Revitalisierung des Modells Deutschland muss die Gesetzgebung endlich tätig werden und die Tarifbindung in Deutschland nachhaltig stärken, durch beispielsweise die Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung.
Strom aus Windkraftanlagen und die Windkraftanlagenproduktion sind wichtig für Deutschlands Zukunft
Tom Bauermann: Gemessen an den Stromgestehungskosten ist Windenergie deutlich günstiger als fossile Kraftwerke und bietet die Basis für ein zukunftsfähiges Energiesystem (Bauermann 2023). Zugleich zählt die Industrie zur Produktion von Windkraftanlagen bzw. ihren Komponenten zu den Schlüsselindustrien der Transformation. In Deutschland und Europa geht sie mit einer hohen Beschäftigung und Wertschöpfung einher. Eine Abkehr von dieser Technologie wäre für die deutsche Wirtschaft schädlich.
Verlängerung der Mietpreisbremse
Carolin Martin: In Deutschland wird die Abschaffung bzw. Senkung der Grunderwerbsteuer auf Wohneigentum diskutiert, um den Immobilienerwerb zu erleichtern. Außerdem wird gefordert, die Erbschaftsteuer für Immobilien zu senken. Diese Maßnahmen gehen am Problem vorbei, würden vor allem einkommensstarke und vermögende Haushalte begünstigen und hätten keinen signifikanten Einfluss auf die Mietpreise, wie Studien zeigen. Höhere Einkommen und Vermögen korrelieren mit größeren Erbschaften, wodurch Steuererleichterungen die Vermögensungleichheit verstärken würden (Rietzler 2023). Selbstgenutzte Immobilien sind schon heute weitgehend von der Erbschaftssteuer befreit. Steuerliche Entlastungen beim Immobilienerwerb adressieren nicht das Kernproblem des Wohnungsmarktes, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum.
Demgegenüber hat die Mietpreisbremse zu einer moderaten Dämpfung des Mietanstiegs geführt. Ohne eine Verlängerung wird sie Ende 2025 auslaufen, was eine unkontrollierte Mietendynamik und einen steigenden Verdrängungsdruck in Städten zur Folge hätte. Um bezahlbaren Wohnraum langfristig sicherzustellen, ist es daher essenziell, die Mietpreisbremse über 2025 hinaus zu verlängern und zu verschärfen. Zwar wird die Mietpreisbremse häufig umgangen, etwa durch überhöhte Mieten bei Neuvermietungen oder möblierte Wohnungen. Um ihre Wirksamkeit zu erhöhen, bedarf es deshalb einer stärkeren Kontrolle, nicht aber einer Abschaffung des Instruments. Zusätzlich sollten öffentliche Wohnungsbauprogramme intensiviert werden, um das Angebot an bezahlbarem Wohnraum nachhaltig zu erhöhen.
Reform der Schuldenbremse und der EU-Fiskalregeln
Sebastian Watzka: Die EU-Fiskalregeln engen den Spielraum für Finanzpolitik unabhängig von der Schuldenbremse ein und setzen auch Grenzen für eine mögliche Reform der Schuldenbremse. Allerdings hindern sie den Gesetzgeber nicht, die Schuldenbremse investitionsfreundlicher zu gestalten, da insbesondere Investitionen, die langfristig das Produktionspotenzial erhöhen, in den neuen Fiskalregeln zusätzliche Verschuldungsspielräume ermöglichen. Darüber hinaus könnte die sogenannte Schuldentragfähigkeitsanalyse, die inzwischen den Kern der neuen EU-Fiskalregeln bildet, reformiert werden, um die Verschuldungsspielräume zu erweitern.
Der Brückenstrompreis unterstützt die Transformation
Tom Bauermann: Die Strompreise an der Strombörse, an denen sich große Industrieunternehmen orientieren, liegen weiterhin über den Preisen von 2021 und sind sehr volatil. Dies erschwert den Umstieg auf eine Elektrifizierung der Produktion, weil es bei den Entscheidungsträgern zu Verunsicherung führt. Es wird allerdings erwartet, dass die Strompreise perspektivisch durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien sinken. Ein zeitlich begrenzter Brückenstrompreis für die Industrie, der an Bedingungen wie Standortsicherung und den klimaneutralen Umbau der Anlagen geknüpft ist, bietet den Unternehmen einen Transformationspfad und unterstützt den Umstieg.
Frauenerwerbsquoten
Ulrike Stein: Um die negativen Effekte des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt und Rentenversicherung zu mildern, bedarf es der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Hier besteht wesentlich größeres Potenzial als bei zusätzlichen Überstunden, zumal die Begünstigung von Überstunden von in Vollzeit erwerbstätigen Männern dazu führen kann, dass Frauen sich verstärkt auf die Familie konzentrieren und ihre Arbeitszeit verringern. Die größten Hürden für eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen sind die Pflegearbeit und das Steuer- und Abgabensystem. Deshalb sollte in den Ausbau und die Verbesserung der Betreuungsinfrastruktur von Kindern und Alten investiert werden. Minijobs, das Ehegattensplitting und die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern in der Krankenversicherung schaffen zudem Fehlanreize, die Frauen davon abhalten, ihr Arbeitsvolumen zu erhöhen. Hier sollten Reformen ansetzen. Großes Potenzial gibt es auch bei der Gruppe der Frauen ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
Qualifikation - Berufsabschluss
Alexander Herzog-Stein: Um die Folgen des demografischen Wandels in Deutschland abzufedern, müssen - neben dem klaren Bekenntnis zu einer gesteuerten Arbeitsmigration - auch die heimischen Potenziale erschlossen und besser genutzt werden. Hierzu muss auch die hohe Zahl an Personen ohne Berufs- oder Hochschulabschluss reduziert werden. Derzeit hat mehr als jede zehnte Person zwischen 18 und 24 Jahren höchstens einen mittleren Schulabschluss, ohne sich in einer weiteren Aus- und Weiterbildung zu befinden (Lindner und Tiefensee 2024, Abb. 3d). Zudem sind rund 2,9 Millionen Personen im Alter zwischen 20 und 34 Jahren nicht formal durch einen Berufs- oder Studienabschluss qualifiziert; Tendenz steigend. Bei dieser Gruppe ist die Erwerbslosenquote traditionell überdurchschnittlich hoch und die Erwerbsquote unterdurchschnittlich niedrig. Es bedarf größerer bildungs- und arbeitspolitischer Anstrengungen und Investitionen, um diesen Personenkreis nicht zurückzulassen und besser zu qualifizieren.
Schuldenbremse und Generationengerechtigkeit
Katja Rietzler: Die Schuldenbremse setzt der Neuverschuldung von Bund und Ländern enge Grenzen. Verteidigt wird die deutsche Fiskalregel oft mit dem Argument, sie gewährleiste Generationengerechtigkeit, aber das ist nicht stichhaltig. Die Regelungen der Schuldenbremse sind blind für die tatsächliche langfristige Belastung durch bestehende Schulden ebenso wie für die Verwendung zusätzlicher Schulden und ihre Rückwirkungen auf das Wachstum. Deutschland hat die niedrigste Schuldenstandsquote aller G7-Länder und die Zinsbelastung ist in Relation zu den Steuereinnahmen weniger als ein Drittel so hoch wie in den 1990er Jahren. Wir können uns kreditfinanzierte Investitionen also leisten und wir sollten es – gerade auch mit Blick auf künftige Generationen. Sie profitieren, wenn wir durch die Realisierung wichtiger Zukunftsinvestitionen – eine Schätzung des IMK und des IW geht von 600 Mrd. Euro in 10 Jahren aus – den Standort Deutschland modernisieren und die Dekarbonisierung voranbringen. Es ist daher auch fair, künftige Generationen nach ihrer Leistungsfähigkeit an den Kosten des Schuldendienstes zu beteiligen. Sie würden hingegen deutlich verlieren, wenn Deutschland durch die Unterlassung von wichtigen Investitionen noch weiter zurückfallen würde.